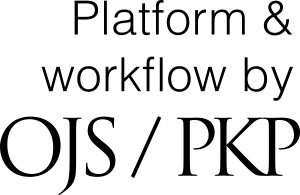Sprache und Metapher in der Konzeption historischer Semiotik und psychologischer Ökologie
Abstract
Bereits 1764 hat der Philosoph und Naturforscher Johann Heinrich Lambert nicht nur betont, dass die Metapher unverzichtbarer und konstitutiver Bestandteil einer hoch entwickelten Sprache sei, sondern auch deren kommunikative Leistung hervorgehoben: die Metapher erlaube es, in der Bezugnahme auf abstrakte Gegenstände einander verständlich zu bleiben und insofern überflüssige “Wortstreite” zu vermeiden (Semiotik, §§ 342-344). Grundlage dieser Einschätzung Lamberts ist sein Entwurf der Unterscheidung von “Körperwelt” und “Intellektualwelt”, demzufolge “äußerliche Empfindungen”, das heißt die Wahrnehmung des Konkreten, abzutrennen sind von “inneren Empfindungen”, die sich auf die Vorstellung abstrakter und unsichtbarer Dinge beziehen (Alethiologie, § 46). Die Problematik von Kommunikation unter derartigen Innen- und Außenorientierungen bleibt im 20. Jahrhundert und bis in die unmittelbare Gegenwart thematisch. Im Horizont psychologisch orientierter Ökologie und philosophischer Anthropologie steht die Frage des Verhältnisses von Psyche und Umwelt (Willy Hellpach, Sozialpsychologie in erster Auflage 1933 und erneut 1946), inneren und äußeren Erfahrungen (Max Scheler, Helmuth Plessner) im Zentrum der Aufmerksamkeit. In der hier anknüpfenden Reflexion von Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Verständigung wird die auf den Sprecher fokussierte Ausdrucksperspektive durch eine hörerseitig konzentrierte Eindrucksorientierung abgelöst und der Metapher wiederum verständigungssichernde Funktionen zuerkannt (Gerold Ungeheuer). Vor dem dargelegten theoretischen Hintergrund soll die Bedeutung skizziert werden, die sozialen und kulturellen Aspekten von Umwelt für das Sprachverhalten und -handeln zugewiesen werden kann.