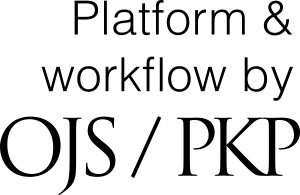The Role of Conceptual Metonymy in Meaning Construction
Abstract
In diesem Artikel argumentieren wir, dass abstrakte Schlussprinzipien, die auf Griceschen Maximen oder sogar nur auf einem einzigen Relevanzprinzip beruhen, nicht angemessen erklären können, wie Interaktanten Äußerungsbedeutungen tatsächlich erschließen. Wir plädieren für die Existenz einer unterhalb dieser abstrakten inferenziellen Prinzipien angesiedelten Ebene von metonymischen Schlussprinzipien, die einerseits allgemein genug sind, um als Inferenzschemata zu dienen, aber andererseits auch einen hinreichend spezifischen Gehalt haben, um als “Wegweiser” für die Erschließung von Äußerungsbedeutungen zu fungieren. Wir definieren eine ‘konzeptuelle Metonymie’ als eine kontingente, d.h. nicht-notwendige Beziehung zwischen einer Ursprungsbedeutung und einer Zielbedeutung innerhalb einer konzeptuellen Domäne, wobei die Ursprungsbedeutung den mentalen Zugang zur Zielbedeutung erleichtert. Wir betrachten solche metonymischen Beziehungen als flexible kognitive Werkzeuge, die nicht nur in der Sprache, sondern auch in anderen Zeichensystemen und im Denken Anwendung finden. In einer prototypischen Metonymie ist die Zielbedeutung dominanter, d.h. mehr im Fokus der Aufmerksamkeit, als die Ursprungsbedeutung. Prototypische Metonymien ermöglichen nicht nur den mentalen Zugang zu Zielbedeutungen, sondern stehen, beispielsweise als neues Thema, zur weiteren Bearbeitung im nachfolgenden Diskurs verfügbar. Metonymien in diesem Sinne sind in der natürlichen Sprache als konzeptuelle Prozesse allgegenwärtig. Sie manifestieren sich auf der referenziellen, prädikativen und illokutiven Ebene, und sie strukturieren das Lexikon, interagieren mit der Grammatik und spielen eine Schlüsselrolle in der Produktion und dem Verstehen pragmatischer Bedeutungen.