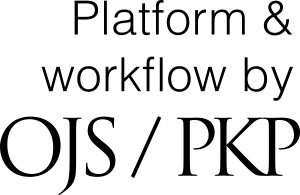Problemgeschichte in Metaphern
Am Beispiel der Elektrizitätslehre um 1800
Abstract
Im späten 18. Jahrhundert expandieren Konzepte der Elektrizitätslehre aus der Physik in Physiologie sowie Psychologie, als Metaphern zudem auch in das allgemeine Gefühlsvokabular, besonders auf dem Terrain einer neuen Inspirations- und Liebessemantik. Diese Konjunktur lässt sich dadurch erklären, dass die Elektrizität als Versprechen gilt, zentrale Desiderate der Anthropologie und Naturlehre der Aufklärung einzulösen und inhärente konzeptionelle Spannungen zu beheben (Einzelnes und Naturganzes, Organik und Anorganik, Geist und Materie). An diesem historischen Einzelbeispiel zeigen sich allgemeine Kapazitäten von Metaphern in Bezug auf epochale ‚Probleme‘: Sie können die sprachlichen Mittel an eine neue Problemsituation anpassen, eine implizite Heuristik von ‚Lösungen‘ geben, an der Bildung von neuen Modellen mitarbeiten, Probleme kontextualisieren und dämpfen, zuweilen aber auch ausweiten und forcieren. Aufgrund dieser Eigenschaften, die schon Metaphern zukommen, in der germanistischen Diskussion aber oft erst literarischen Texten zugeschrieben werden, kann der metaphorologische Zugriff die Methodologie der ‚literaturwissenschaftlichen Problemgeschichte‘ vertiefen und ergänzen.