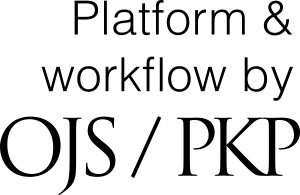Theatrum Belli
Der Krieg als Inszenierung und Wissensschauplatz im 17. und 18. Jahrhundert
Abstract
Der Metaphorik des Theaters kam ein zentraler Stellenwert für die frühmoderne militärische Publizistik und insbesondere die frühneuzeitliche Kriegsberichterstattung zu. Als Theatrum belli bzw. als Kriegstheater bezeichnete man meist den Kriegs-Schauplatz, also den konkreten geographischen Raum des Kriegsgeschehens. Doch auch die Darstellung der eigentlichen Kampfhandlungen in Form von Schlachten und Belagerungen folgte einer Sprache der Inszenierung. Das Schlachtfeld wurde zur Bühne, die Soldaten zu Akteuren, eine Niederlage mitunter zur Tragödie verklärt. Ausgehend von der Beobachtung, dass das Wissen über den Krieg sich in den von der europäischen Adelsgesellschaft geprägten diskursiven Formen realisierte, kann die Theatralisierung des Krieges als Ausdruck seiner Eingebundenheit in die soziale Logik der höfischen Repräsentation gelesen werden. Geometrie und Überschaubarkeit wurden zu zentralen Axiomen einer Ästhetik der Kriegskunst. Auch die kriegerische Gewalt selbst wurde zumindest dem Anspruch nach in der Choreographie einer genau festgelegten Inszenierung aufgehoben. Die Evidenz der militärischen Theatrum-Metapher war innerhalb der zeitgenössischen Wissenskultur offenbar so stark, dass die Begriffsverwendung die eigentliche Kernphase der Theatrum-Metaphorik weit überdauerte. Seit dem 19. Jahrhundert verlor sich diese – als bloßer Schein diskreditierte – Beschreibungsebene allmählich. Was bleibt ist der geographische Begriff des Kriegstheaters.