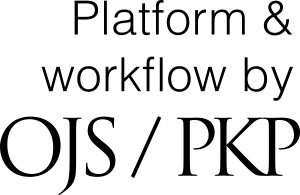Call for Papers Ausgabe 11: Erschöpfung
Die Figur der Erschöpfung ist zu einer Schlüsselmetapher spätmoderner Gesellschaften geworden. Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache kennt zwei Bedeutungen von ‚erschöpfen’: „etw. völlig nutzen, bis nichts mehr übrig bleibt” und „jmnd. bis zur Kraftlosigkeit ermüden” (DWDS o. J.). Alain Ehrenberg hat in seiner vielbeachteten Studie Das erschöpfte Selbst (2004) die Diagnose gestellt, dass der Übergang von einer Disziplinar- zu einer Leistungsgesellschaft mit neuen Subjektivitätsformationen einhergeht: Nicht mehr das Übertreten von Normen, sondern das Scheitern an den Anforderungen von Autonomie, Selbstverwirklichung und Leistungsbereitschaft rückt ins Zentrum gesellschaftlicher Pathologien. Darauf aufbauend haben zahlreiche Autor:innen die Frage nach den sozialen, politischen und kulturellen Dimensionen von Müdigkeit, Burnout und Überforderung gestellt (vgl. Han 2010; Rosa 2013; Illouz 2019).
Erschöpfung zeigt sich jedoch nicht allein auf der Ebene des Subjekts. Ressourcenknappheit, ökologische Krisen und geopolitische Konflikte lassen sich ebenso unter dem Signum der Erschöpfung deuten (Latour 2017; Moore 2015). Zugleich verweisen Debatten um Mental Load und Care-Arbeit auf die ungleiche Verteilung von Belastungen in Geschlechter- und Machtverhältnissen (van Dyk/Haubner 2021). Politisch betrachtet lässt sich Erschöpfung als Symptom demokratischer Ermüdungsprozesse (Hochschild 2017) oder als Motor neuer Formen der Mobilisierung analysieren.
Vor diesem Hintergrund lädt die Redaktion Beiträge ein, die das Thema Erschöpfung aus unterschiedlichen theoretischen, empirischen und (inter-)disziplinären Perspektiven bearbeiten. Mögliche Themenfelder für etwa kultur-, politik- oder sozialwissenschaftliche Analysen sind u. a.:
Lesen Sie mehr über Call for Papers Ausgabe 11: Erschöpfung


 Von Fridays for Future über die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit bis zu #metoo – nach Jahrzehnten postdemokratischer Apathie findet eine Wiederentdeckung öffentlicher Räume und des politischen Protestes statt, insbesondere im Ausdruck von Gefühlen. Eine Diagnose, die gleichfalls für rechtsnationale Bürger*innenbewegungen gelten muss. Seit dem „Wutbürger“ stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang solche Widerstände mit Politiken stehen, die bestimmte Gefühle und/oder Affekte strategisch zu orchestrieren versuchen: Wie also wirken Gefühle/Affekte in individuellen wie kollektiven Widerständen? Welche medialen Formen nehmen sie im Netz oder in der Kunst an? Und welche Bedeutung kommt Gefühlen/Affekten in der Erforschung dieser Widerstände überhaupt zu?
Von Fridays for Future über die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit bis zu #metoo – nach Jahrzehnten postdemokratischer Apathie findet eine Wiederentdeckung öffentlicher Räume und des politischen Protestes statt, insbesondere im Ausdruck von Gefühlen. Eine Diagnose, die gleichfalls für rechtsnationale Bürger*innenbewegungen gelten muss. Seit dem „Wutbürger“ stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang solche Widerstände mit Politiken stehen, die bestimmte Gefühle und/oder Affekte strategisch zu orchestrieren versuchen: Wie also wirken Gefühle/Affekte in individuellen wie kollektiven Widerständen? Welche medialen Formen nehmen sie im Netz oder in der Kunst an? Und welche Bedeutung kommt Gefühlen/Affekten in der Erforschung dieser Widerstände überhaupt zu?