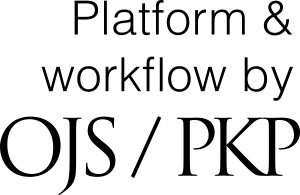Bd. 9 Nr. 1 (2025): Das Starke im Schwachen und das Schwache im Starken?

Der Begriff der 'Vulnerabilität' hat sich zu einem Kernkonzept in gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Diskussionen rund um sozial ungleich verteilte Zugänge zu Gesundheit und Unversehrtheit, materiellen Ressourcen und sozialer Wertschätzung entwickelt. Die Verbreitung von Vulnerabilitätsdiskursen hängt maßgeblich mit dem Erfolg sozialer Bewegungen zusammen, welche die Diskriminierung sozialer Gruppen mit Verletzbarkeit in systematischen Zusammenhang brachten. Beispielsweise tragen feministische Kämpfe gegen sexualisierte Gewalt dazu bei, FLINTA* als vulnerabel zu konstruieren, um basierend darauf entsprechende Maßnahmen der Unterstützung und des Schutzes einzufordern. Zur Begründung ihrer Forderungen argumentieren derweil Klimabewegungen, dass besonders junge Menschen langfristig von den Auswirkungen der globalen Klimakatastrophe betroffen seien. Und auch während der Corona-Pandemie wurde in hitzigen medialen Debatten verhandelt, wer als besonders schutzbedürftig gilt und welche Ansprüche und Regeln sich daraus ableiten lassen. In den Beispielen zeigt sich, wie die Legitimation von und das Einstehen für Rechte, Privilegien und Maßnahmen für Menschen einer sozialen Gruppe (oder Gruppenzuschreibung) in öffentlichen Diskussionen vielfach eng an die Konstruktion eben jener Kategorien als vulnerabel geknüpft wird. Im wissenschaftlichen Kontext spielt Vulnerabilität daher nicht nur als Forschungsthema verschiedener Disziplinen eine Rolle, sondern findet sich auch in Diskussionen und Kodizes zur Forschungsethik, die oftmals für vulnerable Gruppen einen besonderen Schutz im Forschungsprozess fordern (u. a. Ethikkodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie).
Die gesellschaftlich gewachsene Sensibilität für die Vulnerabilität bestimmter Gruppen geht einher mit diskursiven Auseinandersetzungen, um die Frage, wer wen legitimerweise als vulnerabel bezeichnen darf. Im Gegensatz dazu zeigen Empowerment-Diskurse, dass persönliche Resilienz und Stärke auch erklärtes Ziel emanzipativer Bemühungen sind. Pädagogische Diskurse fragen beispielsweise nicht nur, wie vulnerable Kinder geschützt werden können, sondern auch, welche Faktoren sie stark und resilient werden lassen. Ebenso richten sich Körper- und Gesundheitsdiskurse auf die Abwehr und Stärkung des eigenen Körpers und dessen Gesundheit (Challenges, Selftracking u. a.). In der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel sollen Gebäude, Städte und Infrastruktur zunehmend resilient gestaltet werden, um Extremwetterereignissen trotzen zu können, während die sich verschärfenden internationalen Spannungen die Frage aufwerfen, ob nicht die militärische, ökonomische oder diplomatische Stärke wieder das geeignete Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen ist. Die neunte Ausgabe von diskurs widmet sich also dem Verhältnis von Resilienz, Stärke und Vulnerabilität.